2,5 Trillionen Byte Daten produzieren wir jeden Tag weltweit. Auch im Job wird Big Data immer wichtiger – manche Firmen rechnen sogar aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir kündigen. Ein Beitrag von Anne Hemmes (PULS).
Myrna Arias ist Angestellte beim Geldtransfer-Unternehmen Intermex in Kalifornien und hat mit einer Klage weltweit für Aufsehen gesorgt. Sie wollte nicht von ihrem Chef überwacht werden, nicht in ihrer Freizeit. Aber sie und ihre Kollegen sollten eine App namens Xora runterladen. Mit der wurden sie per GPS getrackt, 24 Stunden lang. Ihr Chef gab sogar damit an, dass er jetzt wüsste, wann sie mit dem Auto mal zu schnell gefahren sei. Myrna Arias beschwerte sich, dass damit ihre Privatsphäre verletzt würde. Außerdem sei die 24-Stunden-Überwachung nicht legal. Sie verglich es mit einem Gefangenen, der eine Fußfessel tragen muss.
Aber Arias‘ Chef sagte, dass sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für Kunden erreichbar sein müsse. Auch wenn das nicht ganz legal sei, solle sie das doch akzeptieren, schließlich verdiene sie so gut bei der Firma. Arias wollte das so nicht stehen lassen. Sie löschte die App von ihrem Diensthandy. Kurz darauf wurde sie gefeuert – dagegen hat sie jetzt geklagt.
Ihre Anwältin Gail A. Glicks sagt:
Das verletzt unser verfassungsmäßiges Recht auf Privatsphäre. Die kalifornische Verfassung schützt unser Recht auf Privatsphäre genauso wie die amerikanische Verfassung. Und die kalifornische Verfassung schützt den Einzelnen vor dieser Verletzung der Privatsphäre – sei es durch Firmen oder die Regierung.
Glicks glaubt, dass die Klage Erfolg haben wird:
Wir glauben, dass dieser Fall dazu führen könnte, dass mehr Gesetze erlassen werden, die Arbeitnehmer vor solchen Eingriffen durch den Chef oder die Firma, die Technologien wie GPS-Tracking einsetzen, schützen.
Unternehmen im Big Data-Rausch
Der Fall aus den USA ist ein krasses Beispiel, aber auch bei uns wird Big Data im Job immer wichtiger. Allein durch die schiere Masse an Daten. Mit immer besseren Tools analysieren Wissenschaftler Datenmengen ganz gezielt – aus Daten der Vergangenheit soll sich so die Zukunft berechnen lassen. Predictive Analytics nennt sich das.
Eine aktuelle Studie vom Digitalverband Bitkom und dem Geschäftskontakte-Netzwerk LinkedIn zeigt, dass jede vierte Firma in Deutschland offen für Big Data ist. Ganz vorne mit dabei sind die Branchen Chemie, Verkehr, die Pharmabranche und Firmen aus der Logistik und dem Finanzbereich. Laut der Studie werten viele Firmen schon jetzt interne Daten wie Name, Adresse, Krankheitstage, Urlaub, Anwesenheit oder Bezahlung aus.
Das klingt erstmal nicht dramatisch, schließlich ist es kein Geheimnis, dass ein Arbeitgeber solche Informationen über seine Mitarbeiter besitzt. Aber Big Data hört nicht bei ein paar Excel-Tabellen mit Standardinfos auf: Viele Firmen hätten gerne auch Daten, die nicht direkt etwas mit dem Job zu tun haben – zum Beispiel Posts oder Profile in sozialen Netzwerken oder Daten aus Jobportalen.
Schnüffeldienst gegen Mitarbeiter
Die Firmen hoffen, aus diesen Datensätzen Schlüsse ziehen zu können, was sie in Zukunft besser machen können – zum Beispiel welche Leute man einstellen sollte, welche Mitarbeiter unzufrieden sind und was man tun kann, um sie zu halten. Tim Pröhm ist im Beirat bei Joberate, einem Big Data Startup aus den USA. Das Startup rechnet in Echtzeit aus, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand kündigt. Dafür werden frei verfügbare Daten unter anderem auch aus sozialen Netzwerken genutzt, die Joberate von Dritten kauft.
Tim Pröhm sieht darin kein Problem:
Es geht letztendlich darum, dass Joberate sich anguckt, was man normalerweise in den sozialen Netzwerken macht und dann wird untersucht: Ändert sich das Verhalten? Das muss man sich vorstellen wie einen Pulsmesser beim Joggen, der irgenwann ausschlägt und von der Norm abweicht. Es mag sein, dass jemand auf Twitter bestimmten Karrierekanälen folgt, auf Facebook bestimmte Karriereseiten liket oder auf LinkedIn sein Profil aktualisiert. All das sind Spuren, die man willentlich hinterlässt, die letztendlich ausgewertet werden können.
Das ungeliebte Wörtchen Datenschutz
In Deutschland sei der Datenschutz strenger als in den USA oder England, sagt Pröhm. Und der Fokus von Joberate liege nicht darauf, zu schauen, wer als nächstes kündigt. Es gehe mehr darum, herauszufinden, wer sich für neue Jobs interessiert und wen welche Firma anwerben kann, weil sie gut zusammenpassen – zumindest laut Datensatz.
Ein fahler Beigeschmack bleibt, denn: Mit meinen Daten werde ich berechenbar für andere. Aus Daten, die ich vielleicht unbewusst mal irgendwo hinterlassen habe, werden Entscheidungen über mich getroffen. Ziemlich gruselige Vorstellung. Und dass dazu auch Daten genutzt werden, bei denen ich nicht im Entferntesten daran dachte, damit irgendetwas jobmäßiges über mich preiszugeben, ist gar nicht mehr so unrealistisch. Die Studie von LinkedIn und Bitkom hat rausgefunden, dass viele Firmen bei uns Daten aus sozialen Netzwerken zwar noch nicht so sehr nutzen, aber es gerne würden.
Das glaubt auch Tim Pröhm:
Ich glaube nicht, dass die Firmen sagen, sie wollen es nicht. Ich glaube, es läuft häufig darauf hinaus, dass man es nicht kann. Denn die Jobbezeichnung des Data Scientist gibt es noch nicht allzu lange. Das ist glaube ich das größte Problem, das wir in Deutschland aktuell sehen: Dass es eine Vielzahl an Daten und Informationen gibt in den internen Systemen der Unternehmen, aber niemand hat es bisher geschafft, die zu verknüpfen.
Firmen in Deutschland sind gerade erst dabei, Big Data für sich zu entdecken. Und es wird mehr: Die International Data Corporation hat ausgerechnet, dass das Big Data-Geschäft bis 2017 ordentlich wächst – um etwa ein Drittel pro Jahr.
Den Originalartikel mit zahlreichen Zusatzinfos und Klicktipps finden Sie bei PULS, dem Jugendprogramm des Bayerischen Rundfunks.

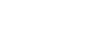








Last Comments